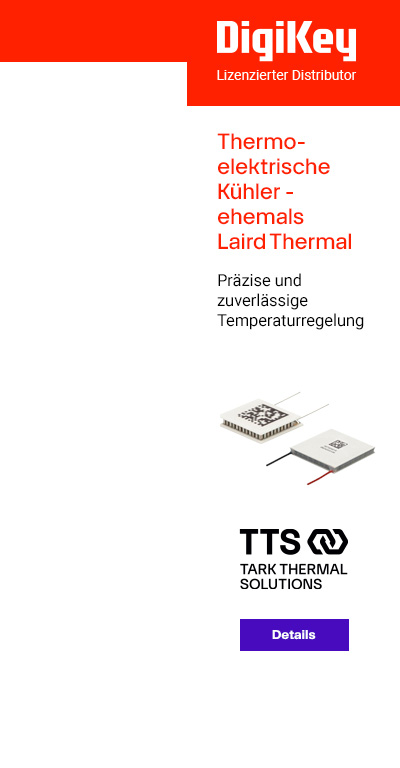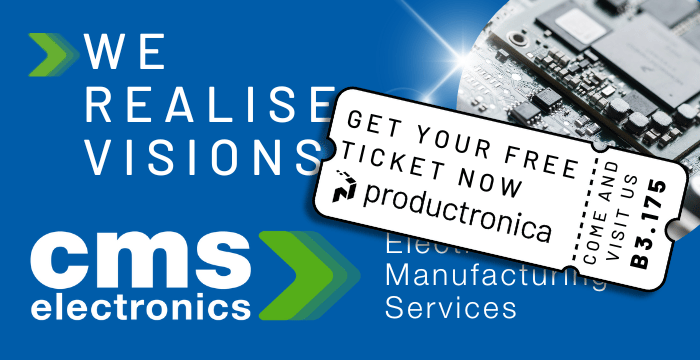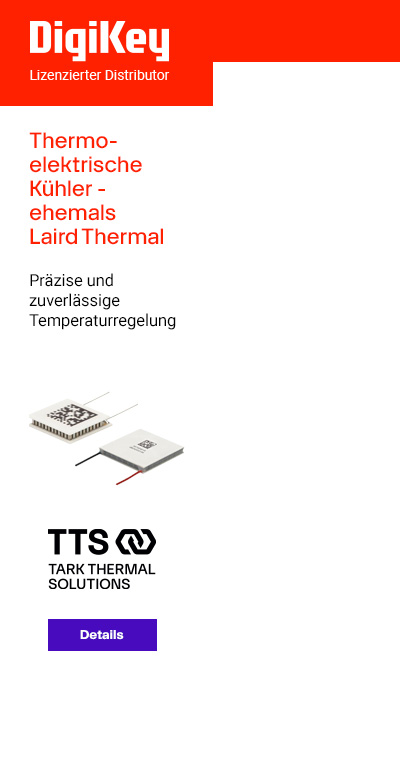Der Lebenszyklus von Komponenten kollabiert unter dem Gewicht des eigenen Fortschritts
Die eigentliche Krise besteht nicht darin, dass Obsoleszenz eintritt – sondern darin, dass die Industrie noch immer so tut, als würde sie nicht eintreten.
Es ist nicht so, dass die Elektronikindustrie die Bedrohung durch Obsoleszenz nicht kennt. Vielmehr verhält sie sich zunehmend so, als wäre es ihr egal. Trotz immer deutlicherer Warnungen ist das beschleunigte Innovationstempo – einst als Fortschritt gefeiert – zu einem Risiko geworden. Die Lebensdauer fortschrittlicher Halbleiter ist von Jahrzehnten auf nur wenige Jahre geschrumpft, und sofortige Obsoleszenz ersetzt die geordnete End-of-Life-Planung. Dennoch verlassen sich zu viele Unternehmen weiterhin auf überholte Annahmen und reaktive Strategien. Die Krise betrifft nicht nur verschwindende Komponenten – sie liegt in der Selbstzufriedenheit, die sicherstellt, dass sich das Problem weiter verschärft.
Wenn es eine Sache gibt, in der sich Experten für Obsoleszenzmanagement einig sind, dann diese: Das Problem ist nicht die Überraschung – es ist die Verleugnung. Unternehmen wissen, dass es kommt. Sie wissen nur nicht, wie sie damit umgehen sollen. Oder schlimmer noch – sie tun so, als müssten sie das gar nicht. Wie Strauße stecken sie den Kopf in den Sand und hoffen, dass die Bedrohung vorüberzieht. Spoiler: tut sie nicht. Und wenn sie an die Tür klopft, zahlen Unternehmen den Preis in Form von hektischen Redesigns, überhöhten Spot-Buy-Preisen, verlorener Produktionszeit – oder dem endgültigen Rückzug vom Markt.
Das Ausmaß des Problems ist kaum zu übersehen. Laut Daten von Datalynq wurden allein 2023 mehr als 328.000 End-of-Life-(EOL)-Mitteilungen veröffentlicht. Das entspricht durchschnittlich 15 EOL-Mitteilungen und 30 Product-Change-Notifications (PCNs) jeden einzelnen Tag. Rund 35 % aller obsoleten Komponenten unterliegen der sofortigen Obsoleszenz, was vielen Herstellern die Möglichkeit nimmt, zu planen oder Vorräte anzulegen. Noch alarmierender ist der übergeordnete Trend: Die Lebensdauer von Halbleitern ist um mehr als 60 % gesunken – von etwa 30 Jahren auf nur noch 10, oder bei modernen Bauteilen sogar weniger. In diesem Umfeld ist Obsoleszenz kein „Vielleicht“ mehr – sondern ein Countdown.
Und es bleibt nicht bei der Verfügbarkeit. Obsoleszenz zu ignorieren stört nicht nur die Produktion – es öffnet auch Tür und Tor für Fälschungsrisiken. Laut ERAI lassen sich fast 43 % aller gefälschten Bauteile auf bereits für obsolet erklärte Komponenten zurückführen.
Dies ist eng mit der kulturellen Denkweise der Elektronikindustrie verknüpft – schlank, effizienzgetrieben, reaktiv. Ein Teil des Grundes, warum Obsoleszenz Unternehmen immer wieder überrascht, liegt in der langjährigen Abhängigkeit der Branche von Just-in-Time-(JIT)-Fertigung.
Was einst als Goldstandard schlanker Effizienz galt, wirkt im Angesicht plötzlicher Störungen zunehmend zerbrechlich. JIT funktioniert, wenn die Welt stabil ist – wenn Prognosen stimmen, Lieferanten verlässlich sind und die Nachfrage konstant bleibt. Doch Obsoleszenz hält sich nicht an Zeitpläne und kümmert sich nicht um Lageroptimierung. Wenn ein zentrales Bauteil über Nacht verschwindet und keine Sicherheitsbestände existieren, bietet JIT keinen Rettungsanker. Es ist ein elegantes System – bis es kollabiert. Doch in einem Markt, der von Volatilität und schrumpfenden Lebenszyklen geprägt ist, tritt dieser Kollaps häufiger ein, als Unternehmen zugeben möchten.
Obsoleszenz ist längst kein fernes Risiko mehr – sie ist tägliche Realität. Die Sucht der Industrie nach kurzfristiger Effizienz, ihre Überabhängigkeit von JIT-Strategien und ihre kulturelle Resistenz gegenüber proaktiver Planung haben einen perfekten Sturm geschaffen. Und dennoch reagieren wir immer wieder überrascht. Die Lösung liegt nicht nur in besseren Prognosen oder klügerer Beschaffung – sondern in einem veränderten Mindset. Obsoleszenz muss als Design-Constraint verstanden werden, als Diskussionsthema im Vorstand und als gemeinsame Verantwortung entlang der Lieferkette. Denn die Teile werden verschwinden.
Wie also können Unternehmen den Kreislauf aus Verleugnung und hektischen Reaktionen durchbrechen? Basierend auf Gesprächen mit Experten im Obsoleszenzmanagement lassen sich vier Prinzipien ableiten, die den Unterschied zwischen „Feuerwehrmodus“ und Voraussicht ausmachen:
- Obsoleszenz anerkennen und antizipieren
- Akzeptieren, dass das End-of-Life von Bauteilen eintritt, auch wenn das Timing unsicher ist.
- Risiken bereits in der Designphase berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf die „Vier-Jahres-Welle“ bei Halbleitern.
- Flexibilität im Design verankern
- Modulare Designs und alternative Pad-Layouts für kritische Komponenten nutzen.
- Software-Portabilität sicherstellen, um zukünftige Hardware-Änderungen zu unterstützen.
- Strukturierte Prozesse etablieren
- Routinen einführen, um Obsoleszenzrisiken regelmäßig zu prüfen.
- Datenbasierte Tools mit menschlichem Urteilsvermögen kombinieren, um teure Fehler zu vermeiden.
- Wissen und Zusammenarbeit stärken
- Internes Know-how zu Obsoleszenzrisiken aufbauen.
- Offene Kommunikation mit Partnern und Lieferanten pflegen, um frühzeitig gemeinsam planen zu können.
Während die Industrie weiterhin mit der beschleunigten Obsoleszenz ringt, werden diese Herausforderungen auch auf der Bühne der Evertiq Expo Gothenburg am 5. September 2025 und der Evertiq Expo Warschau am 23. Oktober 2025 diskutiert. Ronny Nietzsche von Rochester Electronics wird dort den Vortrag „Obsolescence Management starts at Design“ halten und Strategien vorstellen, die bereits in der Designphase helfen können, zukünftige EOL-Risiken zu mindern.