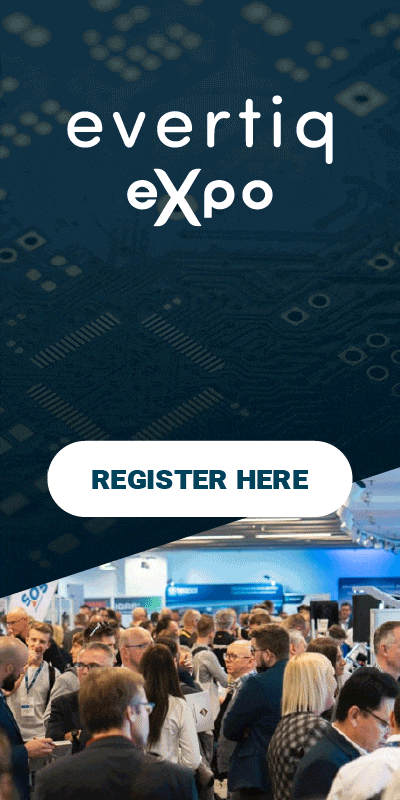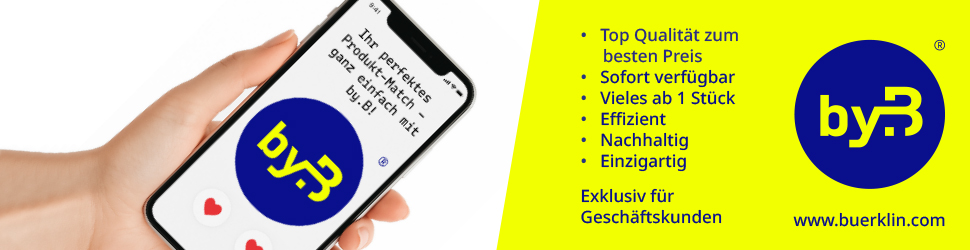TU Braunschweig plant Forschungszentrum für nachhaltige Batterie- und Brennstoffzellentechnologien
Die Technische Universität Braunschweig baut ein neues Forschungszentrum für zirkuläre Batterie- und Brennstoffzellentechnologien. Das geht aus einer Pressemitteilung der TU Braunschweig vom 18. August hervor. Mit dem Center for Circular Production of Next Batteries and Fuel Cells (CPC) entsteht am Research Airport ein Gebäude, das Forschung und Entwicklung künftig enger verzahnen soll. Im Fokus stehen nachhaltige Speicherlösungen und geschlossene Materialkreisläufe. Das Vorhaben wird mit 65 Millionen Euro durch Bund und Land gefördert.
Neue Speichertechnologien sollen aus Braunschweig kommen
Ab dem Jahr 2027 sollen rund 150 Fachleute am neuen CPC daran arbeiten, Technologien für Batterien und Brennstoffzellen grundlegend weiterzuentwickeln. Auf dem 3.700 Quadratmeter großen Areal entsteht ein Zentrum, das verschiedene Disziplinen zusammenbringt – darunter Natur- und Ingenieurwissenschaften ebenso wie Logistik und Verfahrenstechnik. Im Mittelpunkt stehen Speicherlösungen der nächsten Generation: Dazu zählen unter anderem Festkörperbatterien, membranbasierte Durchflussbatterien, Metall-Sauerstoff-Systemen sowie neue Brennstoffzellentechnologien. Ziel ist es, auf diesem Weg zur Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Batteriewirtschaft beizutragen – mit Blick auf eine nachhaltige Kreislaufführung bis zum Jahr 2035. Das Vorhaben fügt sich ein in die HighTech Agenda Deutschland, die gezielt klimaneutrale Technologien fördert.
Prof. Angela Ittel, Präsidentin der TU Braunschweig, sagte:
„Für nachhaltig tragende Ideen braucht es immer Räume. Gedankliche, wie auch materielle. Das CPC wird beides sein: ein Ort für Alchemisten im besten Sinne, die Wissen, Technik und Kreativität verbinden. Und ein Ort für neugierige Entdecker und Entdeckerinnen, die den Mut haben, etablierte Produktionslogiken zu hinterfragen und Neues zu wagen. Wir können das, weil wir an der TU Braunschweig stark sind: Wo andere Abfall sehen, sehen wir Ressourcen. Wo andere Energie verschwenden, schützen wir sie. Hier wird aus linear zirkulär – und Visionen werden Wirklichkeit. Dass ein Bauprojekt mit diesem Tempo und dieser Tragweite entstehen kann, ist beachtlich. Wir leisten schon lange sichtbare Spitzenforschung in diesen Bereichen, und was hier entsteht, verfestigt unsere Position in der Spitzenliga nachhaltig.“
Materialkreisläufe werden von Anfang an mitgedacht
Ein wesentliches Merkmal des neuen Zentrums ist die durchgängige Ausrichtung auf Ressourcenschonung: Statt Recycling erst nachgelagert zu denken, werden Rückgewinnung und Wiederverwertung bereits während der Produktentwicklung mitgedacht. So sollen wertvolle Rohstoffe künftig direkt wieder in den Materialkreislauf zurückfließen – aufbereitet zu hochreinen, wiederverwendbaren Substanzen. Datengetriebene Verfahren, Echtzeitdiagnose und computergestützte Simulationen begleiten die Forschung. Das CPC wird dabei räumlich Teil eines dichten Netzwerks: In direkter Nachbarschaft befinden sich unter anderem die Versuchshalle CircularLab der Battery LabFactory, das Fraunhofer-Zentrum für Energiespeicher (ZESS) sowie Einrichtungen für Fahrzeug- und Luftfahrttechnik.
Forschungsverbund bündelt Kompetenzen und Investitionen
Organisatorisch wird das CPC in den regionalen Forschungsverbund BLB+ eingebettet. Hier kooperieren unter anderem die TU Braunschweig, die TU Clausthal, die PTB, die Fraunhofer-Gesellschaft und die Leibniz-Universität Hannover. Der Verbund will den Transfer zwischen Wissenschaft und Industrie beschleunigen – von der Laboridee bis zur Serienfertigung.
Für den Bau des neuen Forschungszentrums sind insgesamt 73 Millionen Euro vorgesehen. Davon übernimmt das Land Niedersachsen mit Mitteln aus dem Programm zukunft.niedersachsen rund 38,6 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit 26,4 Millionen Euro. Weitere acht Millionen kommen von der TU Braunschweig.