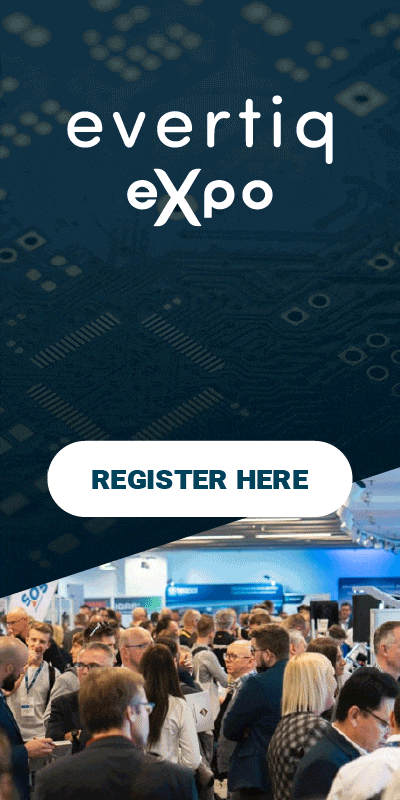Fraunhofer ermöglicht Live-Diagnose für Batterien in E-Fahrzeugen
Ein Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM hat eine Methode entwickelt, mit der sich der Zustand von Batterien direkt während des Betriebs analysieren lässt. Dies gab die Forschungseinrichtung diese Woche auf ihrer Webseite bekannt. Das Verfahren könnte nicht nur die Lebensdauer von Akkus verlängern, sondern auch die Sicherheit von Elektrofahrzeugen und Energiespeichern erhöhen. Dank einer Kombination aus hochfrequenter Messtechnik und intelligenter Datenverarbeitung liefert das System deutlich detailliertere Informationen als bisherige Ansätze – und das nahezu verzögerungsfrei.
Echtzeit-Analyse liefert tiefe Einblicke ins Zellverhalten
Kern der neuen Methode ist die dynamische Impedanzspektroskopie – ein Messverfahren, das weit über bisherige Batteriediagnostik hinausgeht. Während klassische Systeme nur im Ruhezustand arbeiten, erfasst das Fraunhofer-Verfahren Zustandsdaten während des Betriebs. Grundlage ist ein überlagerter Mehrfrequenzstrom, der bis zu einer Million Mal pro Sekunde gemessen und direkt ausgewertet wird.
Um die entstehenden Datenmengen in Echtzeit nutzbar zu machen, kommen spezielle Algorithmen zum Einsatz. Sie reduzieren die Informationsflut gezielt, ohne relevante Inhalte zu verlieren. So entsteht ein präzises Profil des Zellinneren – inklusive State of Charge (SOC), State of Health (SOH) und Informationen zu elektrochemischen Vorgängen. Die Impedanz, also das Verhältnis zwischen Strom und Spannung, dient dabei als zentrale Kennzahl.
Mehr Sicherheit, längere Lebensdauer, breitere Anwendungsfelder
Die Echtzeitdaten liefern nicht nur ein genaues Bild des Ladezustands, sondern erkennen auch kritische Temperaturentwicklungen frühzeitig. Im Fall einer lokalen Überhitzung kann das System sofort eingreifen – etwa durch Abschaltung einzelner Zellen oder Leistungsreduktion. Herkömmliche Temperaturfühler werden dadurch überflüssig.
Auch beim Laden reagiert das System situationsabhängig: Kurze Zwischenstopps ermöglichen schnelles Laden, längere Standzeiten erlauben ein schonendes Ladeprofil – beides schont die Batterie.
Über die Elektromobilität hinaus bietet das Verfahren Vorteile für Energiespeicher in Wind- und Solaranlagen sowie für Anwendungen in Luftfahrt und Schifffahrt. Ein weiterer Pluspunkt: Es ist nicht auf Lithium-Ionen-Technologie beschränkt, sondern auch für alternative Zelltypen wie Feststoff-, Natrium-Ionen- oder Lithium-Schwefel-Akkus geeignet.
"Die dynamische Impedanzspektroskopie eröffnet zunächst neue Möglichkeiten bei der Optimierung des Batteriemanagements und verlängert damit die Lebensdauer der Batterien. Zudem macht sie den Weg frei für den Einsatz der Batterien in sicherheitskritischen Anwendungen", sagte Projektleiter Dr. Hermann Pleteit.