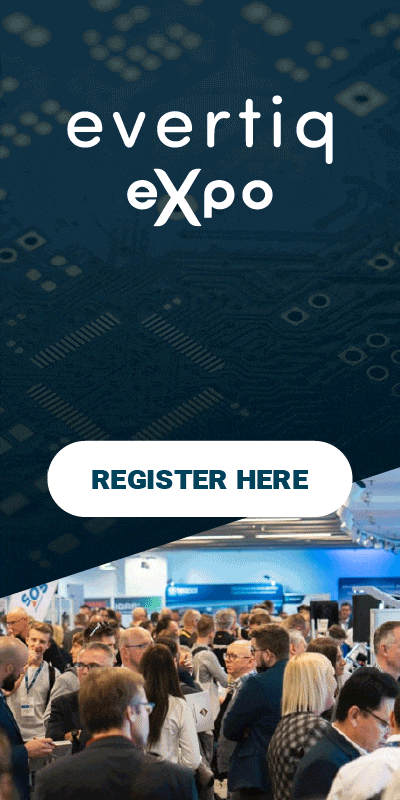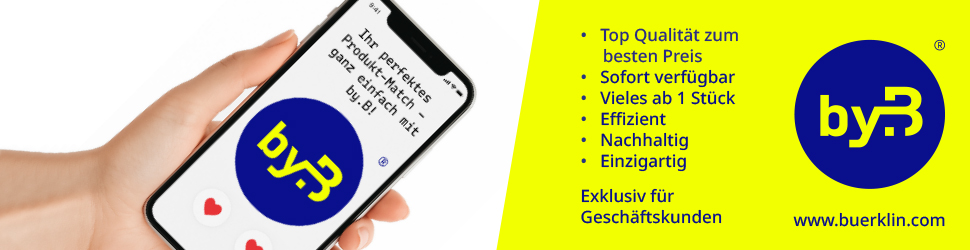© Cool Silicon
Komponenten |
Forschungserfolge beim Energieeffizienz-Cluster 'Cool Silicon'
Kampf den Stromfressern in der Technik – Energieeffizienz in der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) ist das Thema Nummer eins. Erstes Fazit nach zwölf Monaten Forschungsarbeit bei "Cool Silicon": In allen Bereichen konnten die Forscher aus Sachsen neue Erkenntnisse gewinnen und ihre Spitzenforschung vorantreiben.
"Sowohl bei der Mikro- und Nanotechnologie als auch bei Kommunikationssystemen sind wir wesentlich vorangekommen" sagt Cool Silicon-Clusterkoordinator Prof. Thomas Mikolajick. "Bei den Sensornetzwerken konnten wir nachweisen, dass ein autarker, also selbstversorgender, Betrieb durch weitere Optimierung möglich ist", so Mikolajick.
Bundesforschungsministerium und Industriepartner fördern Spitzenforschung "Made in Germany."
Seit 2009 forschen Wissenschaftler und Experten in Sachsen an Innovationen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert "Cool Silicon" im Rahmen des "Spitzenclusterwettbewerbes" mit EUR 40 Millionen, Industriepartner beteiligen sich mit der gleichen Summe und auch das sächsische Wissenschaftsministerium unterstützt das Projekt mit weiteren EUR 30 Millionen.
Angesichts abnehmender Rohstoffressourcen, immer weiteren Leistungssteigerungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und der stärkeren Marktentwicklung suchen die Experten nach zukunftsfähigen Lösungen. Denn: Das stetige Wachstum in diesem Bereich bleibt nicht ohne Folgen. Der Einsatz von IKT-Systemen verursacht mittlerweile zwei Prozent der weltweiten CO2- Emissionen, das entspricht einem Viertel des gesamten Pkw-Verkehrs bzw. genauso hohen Emissionen wie durch den globalen zivilen Luftverkehr.
Die Energiekosten für den Betrieb der IKT-Infrastruktur sind zu einem bedeutsamen ökonomischen Faktor geworden. 64 Forschungsinstitutionen und Unternehmen aus dem Silicon Saxony haben sich dem Thema "Energieeffizienz in der IKT" verschrieben. Ziel ist ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz in der IKT, um Energieressourcen zu schonen und gleichzeitig den CO2-Ausstoss zu minimieren.
Das Silicon Saxony ist das größte europäische Mikro- und Nanotechnologiecluster, insofern liegt es nahe, dass sich die Partner hier vor Ort zusammengeschlossen haben. "Bundeskanzlerin Merkel hat das Engagement von Cool Silicon auf dem IT-Gipfel ausdrücklich gewürdigt", erklärt Prof. Mikolajick.
Area 1 – Mikro- und Nanotechnologien
Im Bereich "Mikro- und Nanotechnologie" beschäftigen sich die Forscher mit den Basistechnologien für energieeffiziente IKT-Produkte und deren Anwendung in Computern. Das Ziel: In Zukunft soll die IT-Branche schon beim Entwurf einzelner Komponenten nicht nur die Rechenleistung, sondern auch die Energieeffizienz optimieren. "Spätestens 2012 ist damit zu rechnen, dass bei einer Nutzungsdauer von drei Jahren die Energiekosten einer großen Serverfarm etwa doppelt so hoch sind wie der Kaufpreis der Computertechnik", sagt der Clusterkoordinator von Cool Silicon.
Ein Team von Cool Silicon hat Testchips entwickelt, die sich bei der so genannten Hochvolttechnologie, die für eine energieeffiziente Spannungsversorgung wichtig ist, einsetzen lassen. Statt über ein Netzteil gelangt die Stromversorgung direkt in den Computer. Vorteil hier: Die Fertigung der Netzteile entfällt komplett und schon allein dadurch lässt sich Energie sparen. "Jeder kennt das: Wenn zum Beispiel das Notebook lange am Stromnetz ist, wird das Netzteil heiß.
 Das ist eine Energieverschwendung, die nun entfällt", erklärt Prof. Mikolajick. Bisherige Tests haben gezeigt, dass die entwickelte Technologie eine Spannung von bis zu 800 Volt aushalten kann. Des Weiteren wurde in Cool Silicon ein neu entwickeltes Open-Source-Programm geschrieben: "Vampir 7" soll es anderen Forschern und Entwicklern ermöglichen, Computer hinsichtlich des Stromverbrauchs und der Einsparpotentiale zu analysieren bzw. diese zu erkennen. Mit dem Programm lassen sich Schwachpunkte in der Energieeffizienz von Computern erkennen. Potentiell ist die Software auch in Rechenzentren und Serverfarmen einsetzbar.
Im Teilprojekt "Cool Fab" geht es um die Optimierung von Abläufen bei der Produktion in der Mikroelektronik bzw. um Einsparmöglichkeiten im Bereich der Herstellungslogistik: Mit der Anzahl der Prozessschritte nehmen auch Transport-, Handhabungs- und Lagerzeiten stetig zu. Mithilfe eines neu entwickelten Software-Werkzeugs ("Logistik Monitoring Center") lässt sich überprüfen, ob man mit Umbauten und Veränderungen von Transportwegen die Produktion optimieren kann.
Diese Software erlaubt es außerdem, die Planung neuer Fabs zu verbessern. Erste Analysen zeigen, dass durch eine Neuanordnung der Fertigungsbereiche Transportreduzierungen von fast 20% theoretisch möglich sind. "Außerdem konnten wir bei den Wartezeiten weitere Optimierungspotentiale finden. Durch den Einsatz robotergeführter Systeme lässt sich zum Beispiel die Arbeitsbelastung für den einzelnen Operator verringern", sagt Prof. Mikolajick.
Auch das trägt zur höheren Effizienz bei der Herstellung von Mikroelektronik: Schnellere Durchläufe und eine optimierte Fertigung können einen wesentlichen Anteil zur Verringerung des Energieverbrauchs sowie zu einer energieeffizienten Produktion von Halbleiterelementen leisten. Zudem sind die erzielten Produktivitätsgewinne von entscheidender Bedeutung, um die Halbleiterfertigung in Dresden im Vergleich zu asiatische Standorten wettbewerbsfähig zu machen und damit Arbeitsplätze zu sichern.
Area 2 – Kommunikationssysteme
An der Verbesserung moderner mobiler Kommunikationssystemen (Software und Hardware) sowie der erforderlichen Systemkomponenten forschen die Experten im Area 2 "Kommunikationstechnologie". Hier geht es um die Entwicklung von Basistechnologien für energieeffiziente Systeme und leichte, webkompatible Endgeräte. Die Blue Wonder Communications GmbH aus Dresden - ein Unternehmen der Infineon Technologies AG - erforscht in diesem Rahmen ein Basisband für ein sehr energieeffizientes Mobilfunkmodem auf Basis des neuen Standards LTE (Long Term Evolution).
Dieses LTE-Modem wurde als FPGA-basierter Demonstrator - BlueGate genannt - aufgebaut und ermöglicht damit das Erforschen, Testen sowie die Optimierung der neuen Technologien hinsichtlich der Verbesserung der Energieeffizienz. Blue Wonder hat mit BlueGate eine Schaltkreisarchitektur entwickelt, in der Techniken zur Verringerung des Leistungsverbrauches um neue Verfahren erweitert wurden. Ein intelligentes Power- Management ermöglicht zudem die für die Datenverarbeitung benötigten Hardware-Komponenten des LTE-Modems im Bruchteil einer Sekunde kurzzeitig zu aktivieren.
Das ist eine Energieverschwendung, die nun entfällt", erklärt Prof. Mikolajick. Bisherige Tests haben gezeigt, dass die entwickelte Technologie eine Spannung von bis zu 800 Volt aushalten kann. Des Weiteren wurde in Cool Silicon ein neu entwickeltes Open-Source-Programm geschrieben: "Vampir 7" soll es anderen Forschern und Entwicklern ermöglichen, Computer hinsichtlich des Stromverbrauchs und der Einsparpotentiale zu analysieren bzw. diese zu erkennen. Mit dem Programm lassen sich Schwachpunkte in der Energieeffizienz von Computern erkennen. Potentiell ist die Software auch in Rechenzentren und Serverfarmen einsetzbar.
Im Teilprojekt "Cool Fab" geht es um die Optimierung von Abläufen bei der Produktion in der Mikroelektronik bzw. um Einsparmöglichkeiten im Bereich der Herstellungslogistik: Mit der Anzahl der Prozessschritte nehmen auch Transport-, Handhabungs- und Lagerzeiten stetig zu. Mithilfe eines neu entwickelten Software-Werkzeugs ("Logistik Monitoring Center") lässt sich überprüfen, ob man mit Umbauten und Veränderungen von Transportwegen die Produktion optimieren kann.
Diese Software erlaubt es außerdem, die Planung neuer Fabs zu verbessern. Erste Analysen zeigen, dass durch eine Neuanordnung der Fertigungsbereiche Transportreduzierungen von fast 20% theoretisch möglich sind. "Außerdem konnten wir bei den Wartezeiten weitere Optimierungspotentiale finden. Durch den Einsatz robotergeführter Systeme lässt sich zum Beispiel die Arbeitsbelastung für den einzelnen Operator verringern", sagt Prof. Mikolajick.
Auch das trägt zur höheren Effizienz bei der Herstellung von Mikroelektronik: Schnellere Durchläufe und eine optimierte Fertigung können einen wesentlichen Anteil zur Verringerung des Energieverbrauchs sowie zu einer energieeffizienten Produktion von Halbleiterelementen leisten. Zudem sind die erzielten Produktivitätsgewinne von entscheidender Bedeutung, um die Halbleiterfertigung in Dresden im Vergleich zu asiatische Standorten wettbewerbsfähig zu machen und damit Arbeitsplätze zu sichern.
Area 2 – Kommunikationssysteme
An der Verbesserung moderner mobiler Kommunikationssystemen (Software und Hardware) sowie der erforderlichen Systemkomponenten forschen die Experten im Area 2 "Kommunikationstechnologie". Hier geht es um die Entwicklung von Basistechnologien für energieeffiziente Systeme und leichte, webkompatible Endgeräte. Die Blue Wonder Communications GmbH aus Dresden - ein Unternehmen der Infineon Technologies AG - erforscht in diesem Rahmen ein Basisband für ein sehr energieeffizientes Mobilfunkmodem auf Basis des neuen Standards LTE (Long Term Evolution).
Dieses LTE-Modem wurde als FPGA-basierter Demonstrator - BlueGate genannt - aufgebaut und ermöglicht damit das Erforschen, Testen sowie die Optimierung der neuen Technologien hinsichtlich der Verbesserung der Energieeffizienz. Blue Wonder hat mit BlueGate eine Schaltkreisarchitektur entwickelt, in der Techniken zur Verringerung des Leistungsverbrauches um neue Verfahren erweitert wurden. Ein intelligentes Power- Management ermöglicht zudem die für die Datenverarbeitung benötigten Hardware-Komponenten des LTE-Modems im Bruchteil einer Sekunde kurzzeitig zu aktivieren.
 Dr. Dieter Hentschel (Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren, Dresden), Leiter des Areas "Sensornetzwerke"
Zusätzliche neuartige Algorithmen zur Verbesserung der Datenübertragung im Uplink und Downlink führen zu sehr kurzen Aktivzeiten des Modems und somit in Summe zur signifikanten Reduzierung des Stromverbrauchs. Das entwickelte Modem unterstützt den aktuell vorgegebenen LTE- Standard nach 3GPP Release 8. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Modems besteht in der Unterstützung beider weltweit eingesetzten LTE-Verfahren (LTE-FDD, TD-LTE) für alle definierten Frequenzbänder. Somit werden in diesem Projekt die Voraussetzungen für ein neues energieeffizientes LTE-Modem geschaffen, welches international in mobilen Endgeräten eingesetzt werden kann.
Forscher an der TU Dresden haben ein neuen energieeffizienten Leistungsverstärker entwickelt. Herkömmliche Geräte sind auf eine maximale Leistung optimiert und verbrauchen deshalb viel Energie. "In Cool Silicon wurde ein Gleichspannungswandler entwickelt, der seine Ausgangsspannung extrem schnell den Leistungsanforderungen einer UMTS-Sendestufe anpassen kann", sagt Prof. Mikolajick.
Hierfür haben die Ingenieure bereits einen entsprechenden Chip hergestellt und erfolgreich erprobt. Ein neu entwickeltes LTE-Niedrigenergie-Mobilfunkmodul ermöglicht eine sehr energieeffiziente Datenübertragungsrate. Mit der Entwicklung eines Multi-Prozessor Energiemanagements für UMTS- / LTE-Systeme wurde die massive Senkung des Leistungsverbrauchs des Leistungsverstärkers in Endgeräten ermöglicht.
Area 3 – Sensornetzwerke
Innerhalb von Area 3 "Sensornetzwerke" entwickeln die Wissenschaftler energieautarke und drahtlos vernetzte Sensorsysteme. Diese sollen unter anderem der Materialüberwachung in Umgebungen dienen, in denen traditionelle Kontrollmethoden nicht anwendbar sind (zum Beispiel in Flugzeugteile einlaminierte Sensoren). Die Anforderungen: energieautark, kabellos, langlebig – mindestens 30 Jahre – und möglichst geringe Herstellungskosten.
Netzwerke aus solchen Sensoren sollen zukünftig Schwingungen von Bauteilen auswerten und so Schäden frühzeitig erkennen. Dazu enthält jeder einzelne Sensor Komponenten zur Erfassung von Messwerten, Prozessoren zur Informationsverarbeitung, eine eigene Stromversorgung und die Möglichkeit zur Datenkommunikation. Die Schwingungen versorgen die Sensoren mit Energie. Piezogeneratoren und hochkapazitive Elemente zur Ladungsspeicherung sollen sicherstellen, dass die drahtlosen Sensoren ohne externe Stromversorgung auskommen.
Hintergrund ist die Prognose einer massiven Zunahme von Sensoren weltweit: Experten gehen davon aus, dass 2017 sieben Billionen drahtlose Sensoren im Einsatz sind – bisherige Sensorknoten benötigen ca. 0,2 W Energie pro Stück. Allein bei einem weltweiten Aktivitätsfaktor von nur einem Prozent liegt das Potential für die Energieeinsparung insgesamt bei zirka 14 Gigawatt (das entspricht etwa 28 Kohlekraftwerken mit einer üblichen Leistung von einem halben Gigawatt). Daher sehen die Forscher daher ihre energieautarken Sensoren nicht nur einen interessanten Markt, sondern auch enorme Potentiale für Energieeinsparungen und CO2-Minimierung durch Innovationen.
Dr. Dieter Hentschel (Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren, Dresden), Leiter des Areas "Sensornetzwerke"
Zusätzliche neuartige Algorithmen zur Verbesserung der Datenübertragung im Uplink und Downlink führen zu sehr kurzen Aktivzeiten des Modems und somit in Summe zur signifikanten Reduzierung des Stromverbrauchs. Das entwickelte Modem unterstützt den aktuell vorgegebenen LTE- Standard nach 3GPP Release 8. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Modems besteht in der Unterstützung beider weltweit eingesetzten LTE-Verfahren (LTE-FDD, TD-LTE) für alle definierten Frequenzbänder. Somit werden in diesem Projekt die Voraussetzungen für ein neues energieeffizientes LTE-Modem geschaffen, welches international in mobilen Endgeräten eingesetzt werden kann.
Forscher an der TU Dresden haben ein neuen energieeffizienten Leistungsverstärker entwickelt. Herkömmliche Geräte sind auf eine maximale Leistung optimiert und verbrauchen deshalb viel Energie. "In Cool Silicon wurde ein Gleichspannungswandler entwickelt, der seine Ausgangsspannung extrem schnell den Leistungsanforderungen einer UMTS-Sendestufe anpassen kann", sagt Prof. Mikolajick.
Hierfür haben die Ingenieure bereits einen entsprechenden Chip hergestellt und erfolgreich erprobt. Ein neu entwickeltes LTE-Niedrigenergie-Mobilfunkmodul ermöglicht eine sehr energieeffiziente Datenübertragungsrate. Mit der Entwicklung eines Multi-Prozessor Energiemanagements für UMTS- / LTE-Systeme wurde die massive Senkung des Leistungsverbrauchs des Leistungsverstärkers in Endgeräten ermöglicht.
Area 3 – Sensornetzwerke
Innerhalb von Area 3 "Sensornetzwerke" entwickeln die Wissenschaftler energieautarke und drahtlos vernetzte Sensorsysteme. Diese sollen unter anderem der Materialüberwachung in Umgebungen dienen, in denen traditionelle Kontrollmethoden nicht anwendbar sind (zum Beispiel in Flugzeugteile einlaminierte Sensoren). Die Anforderungen: energieautark, kabellos, langlebig – mindestens 30 Jahre – und möglichst geringe Herstellungskosten.
Netzwerke aus solchen Sensoren sollen zukünftig Schwingungen von Bauteilen auswerten und so Schäden frühzeitig erkennen. Dazu enthält jeder einzelne Sensor Komponenten zur Erfassung von Messwerten, Prozessoren zur Informationsverarbeitung, eine eigene Stromversorgung und die Möglichkeit zur Datenkommunikation. Die Schwingungen versorgen die Sensoren mit Energie. Piezogeneratoren und hochkapazitive Elemente zur Ladungsspeicherung sollen sicherstellen, dass die drahtlosen Sensoren ohne externe Stromversorgung auskommen.
Hintergrund ist die Prognose einer massiven Zunahme von Sensoren weltweit: Experten gehen davon aus, dass 2017 sieben Billionen drahtlose Sensoren im Einsatz sind – bisherige Sensorknoten benötigen ca. 0,2 W Energie pro Stück. Allein bei einem weltweiten Aktivitätsfaktor von nur einem Prozent liegt das Potential für die Energieeinsparung insgesamt bei zirka 14 Gigawatt (das entspricht etwa 28 Kohlekraftwerken mit einer üblichen Leistung von einem halben Gigawatt). Daher sehen die Forscher daher ihre energieautarken Sensoren nicht nur einen interessanten Markt, sondern auch enorme Potentiale für Energieeinsparungen und CO2-Minimierung durch Innovationen.
 "Wir haben 80 Piezomaterialien untersucht und das richtige gefunden. Daraus haben wir bereits ein erstes System entwickelt", erklärt Prof. Mikolajick. "Und wir können nachweisen, dass der Betrieb der Chips für die Messung und die Datenübertragung allein mit der Energie, die durch Vibration erzeugt wird, im Bereich des machbaren liegt ", sagt er weiter.
"Ein wichtiger Beitrag war auch die Entwicklung eines speziellen Chips, der die Funksignale sendet und gleichzeitig so wenig Strom wie möglich verbraucht. Auch hier sind wir einen großen Schritt weitergekommen", so Mikolajick. Denkbar ist der Einsatz der neuen Sensoren in Flugzeugen aus Kohlefaserverbundstoffen, Flügeln von Windkraftanlagen oder Rädern von Eisenbahnen.
Insgesamt gibt es 192 einzelne technische Projekte, die über Technologie und Wertschöpfungskette miteinander vernetzt sind. Parallel zu den technischen existieren Zentralprojekte, welche die Themen Bildung, Vermittlung der Clusterziele in der Öffentlichkeit und Ausgründungen zum Gegenstand haben.
"Wir haben 80 Piezomaterialien untersucht und das richtige gefunden. Daraus haben wir bereits ein erstes System entwickelt", erklärt Prof. Mikolajick. "Und wir können nachweisen, dass der Betrieb der Chips für die Messung und die Datenübertragung allein mit der Energie, die durch Vibration erzeugt wird, im Bereich des machbaren liegt ", sagt er weiter.
"Ein wichtiger Beitrag war auch die Entwicklung eines speziellen Chips, der die Funksignale sendet und gleichzeitig so wenig Strom wie möglich verbraucht. Auch hier sind wir einen großen Schritt weitergekommen", so Mikolajick. Denkbar ist der Einsatz der neuen Sensoren in Flugzeugen aus Kohlefaserverbundstoffen, Flügeln von Windkraftanlagen oder Rädern von Eisenbahnen.
Insgesamt gibt es 192 einzelne technische Projekte, die über Technologie und Wertschöpfungskette miteinander vernetzt sind. Parallel zu den technischen existieren Zentralprojekte, welche die Themen Bildung, Vermittlung der Clusterziele in der Öffentlichkeit und Ausgründungen zum Gegenstand haben.