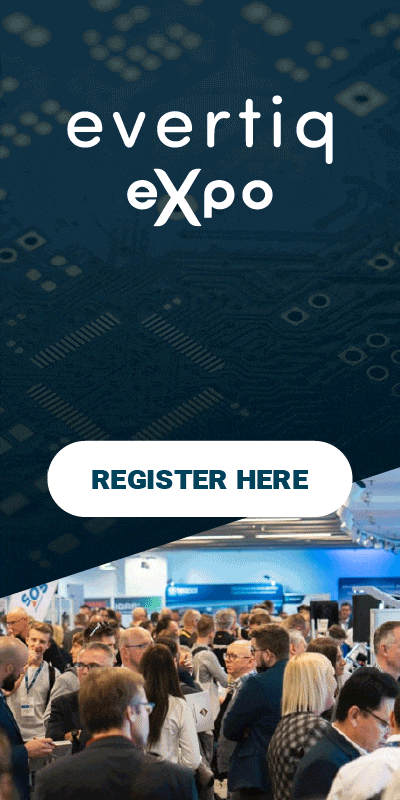© Universal robots - nur zu Illustrationszwecken
Markt |
Weltwirtschaftsforum stellt neue Studie zur Zukunft von Arbeitsplätzen vor
„Die Welt durchläuft eine Arbeitsplatzrevolution, die das Zusammenspiel von Menschen mit Maschinen und Algorithmen revolutioniert“. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie des Weltwirtschaftsforums. Bis zum Jahr 2025 werden demnach mehr als die Hälfte aller laufenden Aufgaben am Arbeitsplatz von Maschinen erledigt werden. Heute sind es rund 29 Prozent.
Ein solcher Wandel werde tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Erwerbsbevölkerung haben, doch in Bezug auf die Gesamtzahl der neuen Arbeitsplätze seien die Aussichten positiv: Bis 2022 sollen 133 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Denen gegenüber stehen rund 75 Millionen verdrängte Posten.
Die Studie „Die Zukunft der Arbeitsplätze 2018“ kommt weiter zu dem Schluss, dass 54 Prozent der Beschäftigten großer Unternehmen erhebliche Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen benötigen würden, um die Wachstumschancen der Vierten Industriellen Revolution voll ausschöpfen zu können. Gleichzeitig gab etwas mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen aber an, nur diejenigen Mitarbeiter umschulen zu wollen, die in Schlüsselpositionen tätig sind, während nur ein Drittel die Umschulung gefährdeter Mitarbeiter plant.
Während fast die Hälfte aller Unternehmen erwartet, dass die Zahl ihrer Vollzeitbeschäftigten bis 2022 aufgrund der Automatisierung zurückgehen wird, rechnen knapp 40 Prozent damit, dass ihre Belegschaft wachsen wird und mehr als ein Viertel geht davon aus, dass die Automatisierung neue Funktionen in ihrem Unternehmen schaffen wird. Zu den Funktionen, die in allen Branchen eine wachsende Bedeutung erlangen werden, gehören dem Bericht zufolge Datenanalysten und Wissenschaftler, Software- und Anwendungsentwickler sowie E-Commerce- und Social-Media-Spezialisten, die alle wesentlich auf Technologien basieren oder durch diese erweitert werden. Auch Funktionen, die ausgeprägte "menschliche Fähigkeiten“ erfordern, wie Verkaufs- und Marketingberufe, Innovationsmanager und Kundendienstmitarbeiter, würden zunehmend nachgefragt.
Zu den Stellen, die voraussichtlich überflüssig werden, gehören die Routinejobs von Büroangestellten wie beispielsweise Sachbearbeitern für Datenerfassung, Buchhaltung und Lohnbuchhaltung.
Mit der sich zunehmend wandelnden Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine werden die Arbeitnehmer neue Fähigkeiten benötigen. Befragte Unternehmen berichten, dass heute 71 Prozent der gesamten für laufende Arbeiten aufgewandten Stunden von Menschen geleistet werden, 29 Prozent von Maschinen. Bis 2022 soll sich dieses Verhältnis auf 58 Prozent auf Seiten der Menschen und 42 Prozent bei den Maschinen verschieben.
Der Studie nach wird die Zukunft der Arbeitsplätze sich nicht einheitlich entwickeln. Je nach Ausgangsbedingungen, verfügbaren Fertigkeiten, Technologieakzeptanz und Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte würden unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelnen Branchen zu spüren sein. Das Ausmaß der Verdrängung von Arbeitsstellen wird voraussichtlich stark variieren. Beispielsweise ist der Anteil der Unternehmen, die mit Arbeitsplatzverlusten rechnen, im Bergbau und in der Metall-, Verbraucher-, Informations- und Technologiebranche höher als bei Unternehmen im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen.
Alle Branchen erwarten erhebliche Qualifikationsdefizite, wobei die Luftfahrt-, Reise- & Tourismusindustrie im Zeitraum 2018-2022 den größten Umschulungsbedarf haben dürfte. Qualifikationsdefizite machen auch den Branchen Informations- & Kommunikationstechnologie, Finanzdienstleistungen & Investoren sowie Bergbau & Metall große Sorgen. Der Mobilitätssektor ist offenbar am wenigsten geneigt, seine derzeitigen Mitarbeiter umzuschulen, während bei Unternehmen aus den Sektoren Global Health & Gesundheitsfürsorge, Chemie, moderne Werkstoffe & Biotechnologie die Umschulungsbereitschaft am höchsten ist.
Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter Personalchefs und Führungskräften aus Unternehmen aus 12 Branchen und 20 Industrie- und Schwellenländern, die zusammen 70 Prozent des globalen BIP ausmachen.